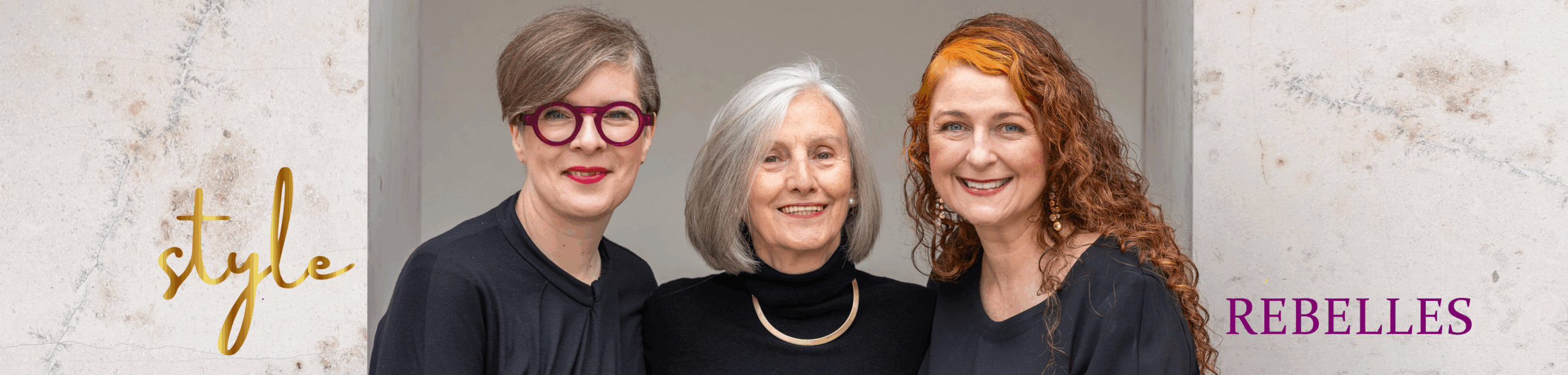Mittlerweile liebe ich Karneval. Wirklich. Die Lieder, den kollektiven Ausnahmezustand in meiner Wahlheimat Köln, sogar dieses Draußen-vor-der-Kneipe-Stehen und Schunkeln, wenn es kalt ist und regnet und man sich fragt, ob man jemals wieder warme Füße haben wird. Und natürlich: die Kostüme.
Das war nicht immer so. Als ich 1999 nach Köln zog, war mir Karneval erst einmal suspekt. Komische Menschen, die einander betrunken in den Armen lagen, seltsame Tänze tanzten und Dinge sangen, die ich nicht verstand. Aber die Kostüme – die habe ich schon immer geliebt. Schon als Kind. Und bis heute.
Ich glaube, richtig gute Kostüme erfüllen einen ganz besonderen Zweck: Sie lassen uns jemand sein, von dem oder der wir uns gern eine Scheibe abschneiden würden. Jemand, den wir bewundern. Oder sie bringen eine Seite in uns zum Klingen, die im Alltag eher leise ist. Manchmal sind sie ein Wunsch, manchmal eine Erinnerung, manchmal eine Verbeugung und manchmal eine Hommage.
Was ein richtig gutes Kostüm für mich ausmacht
Ein gutes Kostüm ist nie nur Stoff. Es sind die Gedanken, die wir uns darum machen. Die liebevollen Details. Die kleinen Props, die das Ganze nicht nur komplettieren, sondern im besten Fall zur Gesprächseröffnung dienen. Kostüme müssen flirten können. Sie müssen Menschen ansprechen. Sie müssen zeigen: Ich habe mir Mühe gegeben.
Natürlich gibt es dafür eine große Bandbreite. Zwischen „scheiße verkleidet im Ganzkörperkostüm“ (danke, Köbes Underground, für diese Weisheit) und dem selbstgenähten, selbstgebastelten, wochenlang durchdachten Kunstwerk liegt eine ganze Welt. Und nein, nicht alles muss selbst gemacht sein. Aber besser schon. Bestes Beispiel: Die Aal Säu und ihre legendären Hüte – jeder ein kleines Meisterstück, und mit so viel Haltung, Witz und Persönlichkeit von Jahr zu Jahr getragen, das sie uns nicht mehr aus dem Gedächtnis gehen.

Mein ü50 Kostüm – und was es über mich erzählt
Verkleiden heißt für mich: wieder Kind sein zu dürfen. Jemand anderes sein dürfen. Für einen Abend, einen Tag, ein paar Stunden. Diese Jahr bin ich „die Mutter von Neo aus The Matrix“. (Nicht ganz so intellektuell, aber doch mindestens so selten wie der Erklärbär, den ich letztes Jahr gesehen habe). Graue Haare, Fake-Leder-Hose, eine Sonnenbrille, ein fake Nokia-Klapphandy, rote und blaue Pillen, ein selbstgebasteltes Tablet mit Filmzitaten, ein kleines weißes Kaninchen. Ein Kostüm, das viel über meine Sozialisation in den 1990ern erzählt, über meinen inneren Nerd. Meine Leidenschaft für Science Fiction und Filme. Und mit den grauen Haaren mit einem Augenzwinkern auch über mein Alter.

Es ist ein Kostüm, das man – wenn überhaupt – erst auf den zweiten Blick versteht. Das oft einer Erklärung bedarf. In vielen Hinsichten ein Insider. Aber genau das mag ich daran. Wer es erkennt, erkennt auch mich ein Stück weit. Wenn nicht, ist es ein guter Start in eine Unterhaltung. (Denn auch wenn ich gefährlich aussehe, bin ich eine von den Guten. Zusammen mit der Tante von Neo und der Mutter von Trinity befreie ich Menschen durch Erkenntnis – und unser Kampf gegen die Maschinen und Computerprogramme zeigt, dass wahre Macht nicht aus Waffen, sondern aus dem Verstehen und Überwinden von Regeln entsteht.)

Die Wahl des eigenen Kostüms hat also immer auch etwas Strategisches
Wenn man jung ist, soll das Kostüm vor allem cool sein, von allen gut gefunden werden. Wenn man Single ist, darf es gern vor allem attraktiv und sexy sein. Und wenn man alt genug ist? Dann reicht es völlig, die eigenen Lieblingsthemen zum Leben zu erwecken oder mit der eigenen Identität zu spielen. Ohne Erklärung. Ohne Agenda. Einfach, zum Spaß haben.
Vielleicht liebe ich Karnevalskostüme genau deshalb so sehr. Weil sie nicht perfekt sein müssen.
Weil sie uns erlauben, für einen Moment genau das zu zeigen, was uns wirklich begeistert. Und weil sie uns dieses ganz leise, schöne Gefühl geben, wenn jemand die Referenz erkennt, kurz innehält und lächelt.