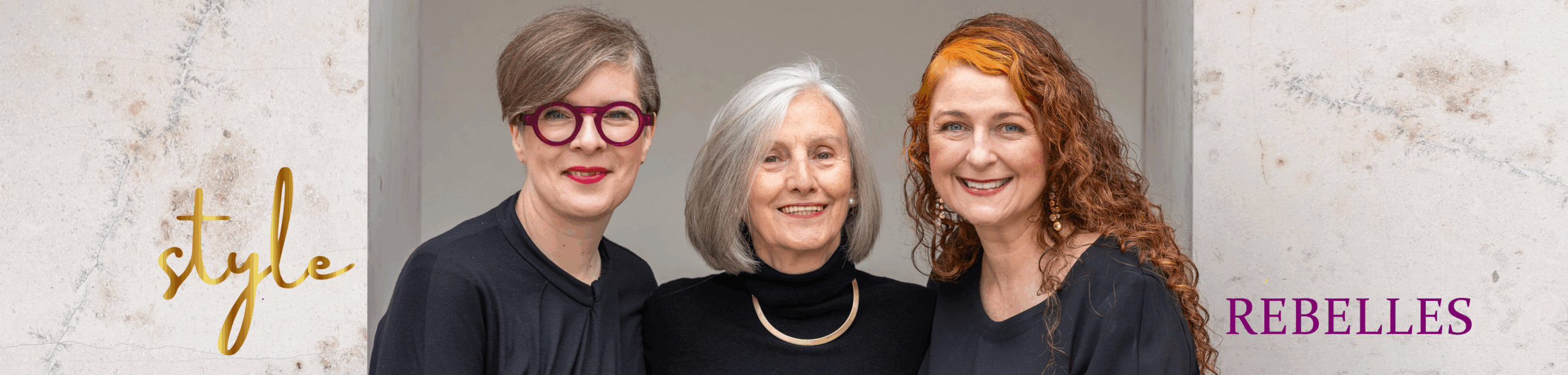Und ich denk noch, Berlin, große Sehnsucht, ich möchte so gerne mal wieder hin, aber ich trau mich noch nicht wegen des Virus, da flattert mir ein herrliches Berlin-Buch auf den Tisch. So war ich endlich in Berlin, das Buch brachte mich hin. Das Großartige: Es erzählt von einer Stadt, die fremd und vertraut ist, vielstimmig und faszinierend. Die wir in diesem Buch ganz neu entdecken, weil sie aus der Perspektive französischer Autor*innen beschrieben wird. In ihren Augen ist das Berlin nach dem Mauerfall in jeder Hinsicht eine Ausnahmestadt.
Und ich denk noch, Berlin, große Sehnsucht, ich möchte so gerne mal wieder hin, aber ich trau mich noch nicht wegen des Virus, da flattert mir ein herrliches Berlin-Buch auf den Tisch. So war ich endlich in Berlin, das Buch brachte mich hin. Das Großartige: Es erzählt von einer Stadt, die fremd und vertraut ist, vielstimmig und faszinierend. Die wir in diesem Buch ganz neu entdecken, weil sie aus der Perspektive französischer Autor*innen beschrieben wird. In ihren Augen ist das Berlin nach dem Mauerfall in jeder Hinsicht eine Ausnahmestadt.
Das Essen
Der Blick in die Berliner Kochtöpfe ist Anlass für großes Missvergnügen. Schon dem Frühstück fehlt jede Finesse. Serviert werden Berge von minderwertiger Wurst („Aufschnittssonderangebote“), Eier und Käse mit einer faden, braunen Flüssigkeit namens Blümchenkaffee. Am Abend wird es richtig schlimm: „Färsenleberklößchen und Salzkartoffeln – mit einer Bananen-Salami-Pumpernickelstulle und Heringen in rosa Mayonnaise, süß wie Bonbonpüree. Ich erfinde nichts.“ resigniert Julien Santoni. Auch die Currywurst wird mit Skepsis betrachtet, wo sie doch „in Berlin das höchste aller Genüsse ist, das Feinste vom Feinen… Die Einheimischen sind ganz versessen darauf, sie würden Gemeinheiten für eine Currywurst begehen. Sie beben schon bis ins Mark, wenn sie, auf die Theke gestützt, das Würstchen brutzeln hören.“
Das Wetter
… ist in Berlin so eine Sache! Das kontinentale Klima lässt im Frühling „die Süße dieser Stadt mit einer triumphalen Geschwindigkeit erstrahlen.“ Herrlich ist der Sommer, mit kühlem Gras „im Schatten von Kiefern, Eichen und Linden, … Ein sanfter Lufthauch strömt die Ufer entlang, zwischen neonfarbenen Joggern, heiteren Radfahrern, Familienpicknicks und dem abdominalen Herausquellen des Biers. Enten, Boote, Badende.“ (Christian Prigent) Den Berliner Winter kann man vergessen. Er ist grau und fahl. „Wahrscheinlich pisst es in diesem Drecksland jeden Tag“, wettert Julien Santoni. Sich selbst zum Trost setzt er hinzu: „Nicht besonders viel Schnee. Frost, ja. Aber immerhin nicht Sibirien.“
Das morbide und das vitale Berlin
Im „fremden Blick“ der Autor*innen wirkt Berlin rau und scheußlich. Endlose Straßen, öde Plätze, „Alleen, so weitläufig wie Landebahnen auf dem Flughafen“, „ein Durcheinander aus grauen Wunden und ineinander verkeilten tristen Gebäuden“,in den Vorstädten Monsterbauten mit Media-Märkten und an jeder Ecke nach Bratfett riechende „grüne Holzhütten“ oder „Verschläge“, die einen Geruch von abgestandenem Bratfett verströmen. Keine schöne Stadt also, nichts für Flaneure. Keine Boulevards, Passagen und Stadtpaläste. Man benutzt die U-Bahn. Doch „hier wird es richtig brutal, mit diesem fahlen Licht und all den Kunstleder-Sitzbänken in Grau, Pipigelb oder Gänsekackbraun.“ Die Fassaden der Häuser sind vom Krieg gezeichnet. „Wohin auch immer man seine Schritte lenkt, man geht auf Asche.“ (Michael Foessel)
Das Stadtbild Berlins ist verloren gegangen. Die Bauten der Gegenwart sind lieblos geplante Ladenzeilen oder welker Bombast. Berlin mag in Bezug zur Referenzgröße Paris ästhetisch unterdeterminiert wirken, doch ist es, wie die Autor*innen feststellen, niemals langweilig. Es ist ein Ort voller Dynamik, urbaner Freiräume und mit einem äußerst lebendigen Kunstbetrieb. Philippe Braz fühlt sich erfrischt wie „in einem NEUEN LAND“. Er stellt fest: In den Stadtbezirken Prenzlauer Berg und Mitte “gibt es alles: die Volksbühne, das Deutsche Theater, das Gorki Theater, den Prater, die Museumsinsel, die Kulturbrauerei, die engsten Freunde, die hervorragenden Cafés, die Erinnerungen an die verschwundene Welt der Juden.“ Inszenierungen wie in Berliner Theatern gibt es nirgendwo sonst. Es „wird geschlagen, geblutet, gekämpft, gefickt.“ Die Berliner lieben ihre Kinos, „in dieser Stadt, in der noch Wim Wenders und Volker Schlöndorff arbeiten, in dieser Stadt, die zwangsläufig die Erinnerungen an die UFA bewahrt, an Fritz Lang, an Murnau, an Pabst, an Lubitsch, an Max Reinhardt, an Sternberg … in dieser Stadt, in der man noch die historischen Filmstudios von Babelsberg besichtigen kann.“
Berliner Alltag
Laut Edgar Morin besteht die Popularität Berlins unter jungen Leuten aus aller Welt in ihrer Offenheit und Lebendigkeit. Sie ist, „voller kleiner Restaurants jedweder Herkunft, sogar neuseeländischer. Jeden Sonntag zieht der Mauerpark, eine sehr ausgedehnte Grünfläche in Prenzlauer Berg im Nordosten von Berlin, Tausende an, junge Leute, Freaks, Bärtige, Tätowierte, Möchtegern-Bohémiens, Paare mit Kinderwagen, einige Vierzig- und Fünfzigjährige, mit den verschiedensten und manchmal seltsamsten Visagen und Klamotten, die umhergehen, im Gras lagern, sich auf die Bordsteine setzen. Am Sonntag meines Besuchs spielt ein Orchester, das einem Film von Kusturica entsprungen scheint, rasend wild Balkanmusik und reißt einige von uns, darunter auch mich, zum Tanzen mit. Es gibt ein Amphitheater mit Sitzreihen, wohin man zu Karaoke-Darbietungen kommt. Auf der ganzen Parklänge durchstreift eine dichtgedrängte Menschenmenge einen riesigen Flohmarkt mit drei bis vier Reihen. Wie auf einem Flohmarkt findet man hier alles, aber auch Biowürste und vegetarische Würste, auch deutsche, russische, amerikanische Soldatenhelme. Diese riesige Ansammlung ist eine Art Berliner Woodstock.“
Auf den Liegewiesen in den weitläufigen Parks und an den Stränden der „Nudistenseen“ sieht man „viel rosiges Fleisch“, fast jeder sei hier unansehnlich, aber zeige sich in seiner Nacktheit ohne jede Scheu. „Die Hinterteile sind bleich, die Bäuche verraten das Bier und die Wurst, die Herren tragen Tätowierungen und die jungen Damen die feministische Beinbehaarung.“ Die Stimmen der Menschen klingen nach aufgebohrtem Auspuff. Die Vermieterin von Serge Mouraret spricht „ein mit Slang durchmischtes Englisch mit derbem Soho-Akzent. Berliner Mischung. Und wenn sie mal einen Satz auf Deutsch fallen ließ, knatterten die Worte in meinen Ohren wie eine Maschinengewehr-Salve, die die Stille der Altbauwohnung in feine Stücke zerhackte – später sollte ich erfahren, dass es eine Eigentümlichkeit der Berliner ist, in Sturzbächen zu sprechen“ (Serge Mouraret).
Berliner*innen seien unprätentiös, stellt Michael Foessel fest. „Es geht weniger darum, gesehen zu werden und aufzufallen, als darum, nach nichts auszusehen und dabei den anderen gegenüber eine tolerante Gleichgültigkeit an den Tag zu legen.“ Glücklich könne sich schätzen, wer in einer Altbauwohnung lebt – „und sie haben nichts mit den Pariser Preisen zu tun“, so Christian Prigent. „Drinnen ist es komfortabel, gemütlich. Man hat zwei oder drei Zimmer von einer großen Eckwohnung des wilhelminischen Berlins abgetrennt. Hohe Decken, Stuck, solides, gewachstes Parkett, schwere Türen, Doppelfenster, um den kalten Nordwind zu foppen. … Die Küche ist so geräumig wie eine Fabrik, weil die preußische Hausfrau viel herumwerkelte und die moderne gerne viel Platz für ihre ökologischen Pflanzungen in Töpfen hat.“
Und dann sind da noch die Eltern vom Prenzlauer Berg mit ihren Lebensmittelkooperativen, schicken Kinderwagen und unautoritär aufwachsenden Kindern! Die Nachbarn von Philippe Braz haben, wie er anerkennend feststellt „in Eigeninitiative eine für alle zugängliche Holzbaracke gebaut, wo man Gebäck und Erfrischungen zu sich nehmen kann, während man die Kleinen beaufsichtigt. … Die Kinder erscheinen nicht wie sozial programmierte Marionetten, sondern wie menschliche Wesen mit ihrer ganz eigenen Empfindsamkeit, mit ihrer Poesie. … Die Kinder, die wir in Berlin treffen, sind vertrauensvoll, lachen viel, leben in Harmonie mit den Möglichkeiten, die ihnen ihr Alter bietet, gehen in ihrem Kindsein auf.“
Fazit
Wer sich für Berlin interessiert, sollte dieses Buch lesen. Es ist mit viel Sorgfalt zusammengestellt, wie man auch an den interessant geschriebenen biographischen Angaben zu den Autor*innen und an der Auswahl schöner Fotos sieht. Natürlich bekommt man beim Lesen eine große Sehnsucht. Man möchte alles liegen und stehen lassen und ins geliebte Berlin-des-Près fahren. Endlich wieder durch Charlottenburg streifen, im Garten des Literaturhauses die Zeit vergessen, am Abend auf der Terrasse eines Restaurants die Passanten beobachten und – ja, unbedingt! – nach Mitternacht eine Currywurst essen. Mit Pommes Frites. Doch vielleicht wartet man auch noch eine Weile und entdeckt, was ich beim Lesen entdeckt habe: Man kann auch reisen ohne zu reisen.
Dorothee Risse und Margarete Zimmermann (Hg.): „Berlin bewegt sich schneller, als ich schreibe“. Das neue Berlin aus französischer Sicht. Erschienen im kleinen, feinen Kulturverlag Kadmos Berlin, 2020. 204 Seiten. Preis: 19,90 Euro